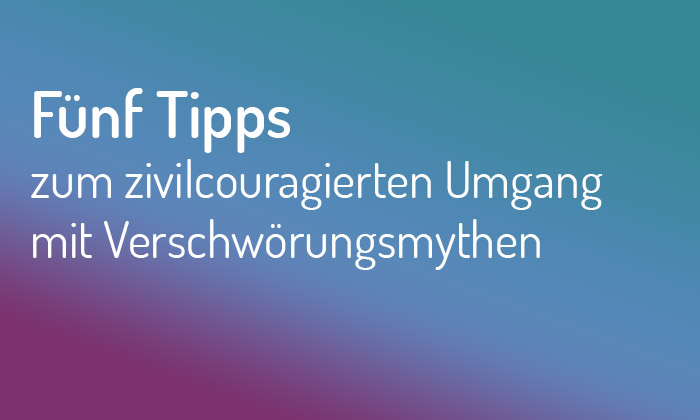Das Internet ist ein Nährboden für Fake News und Verschwörungserzählungen. Gerade in Zeiten der Verunsicherung und einem wachsenden Misstrauen in Staat und Institutionen, haben Verschwörungstheorien hohen Zulauf. Sowohl in den Medien als auch in unserem Alltag begegnen wir immer häufiger den unterschiedlichsten, diffusen Geschichten. Erzählungen über Verschwörungen und geheime Mächte, die das einfache Volk im Hintergrund beherrschen, finden sich seit dem Aufkommen der sozialen Medien verstärkt.
Verschwörungstheorien werden über Messengerdienste verbreitet
Die Narrative folgen in der Regel den immer selben Mustern und erklären Einzelpersonen oder Gruppen zu Sündenböcken Als „Gerüchteküche“ dienen dabei Messengerdienste, wie Telegram oder WhatsApp und soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram, YouTube oder X, wo diese „Theorien“ vielfach weiterverbreitet werden. Hier finden diese Aussagen, anonyme Unterstellungen und Schuldzuschreibungen, teils fanatische Follower. Zunehmende verbale Gewalt und Hass im Netz führen schlimmstenfalls auch zu physischer Gewalt und Vandalismus.
So können Sie Verschwörungstheorien schnell den Wind aus den Segeln nehmen
- Texte und Überschriften kritisch betrachten: Falschmeldungen locken oft mit reißerischen Überschriften und so genannten Clickbaits, die Ihre Emotionen ansprechen. Hier ist Vorsicht geboten: Wenn schockierende Behauptungen in einer Überschrift unglaubwürdig klingen, sind sie es vermutlich auch.
- Quellen genau prüfen: Wo kommt die Information her und ist der Absender vertrauenswürdig? Seien Sie besonders skeptisch, wenn überhaupt keine Quelle angegeben wird oder auf einer Website gar das Impressum fehlt.
- Fakten checken: Sind die Informationen wirklich korrekt, wurde noch in anderen Medien, Zeitungen, Internetseiten darüber berichtet? Dabei helfen auch Faktenchecker-Seiten wie Correctiv.org, Tagesschau.de, Mimikama.at oder BR.de.
- Auf Verschwörungstheorien hinweisen: Weisen Sie den Urheber der Meldung darauf hin, dass er möglicherweise auf eine Verschwörungstheorie gestoßen ist, bzw. eine solche verbreitet. Fordern Sie eine korrekte Quellenangabe. Seien Sie dabei stets respektvoll.
- Problematische Inhalte melden: Inhalte die Fake News oder Verschwörungstheorien enthalten, können direkt beim Onlinedienst als solche gemeldet werden, damit sie gelöscht werden.
Durch generative KI-Anwendungen, wird es zunehmend leichter, „gefaktes“ Material zu erstellen und in gleichem Maße schwieriger, die manipulierten Bilder, Videos oder Tonaufnahmen zu erkennen und von authentischen Inhalten zu unterscheiden. Werden manipulierte Bilder für Fake News genutzt, könnte dies enorme Folgen haben.
Verschwörungsmythen in einem Wimmelbild
Mit spielerischem Charme erleichtert unser Wimmelbild den Zugang zu diesem komplexen Thema und lädt zu Diskussionen ein. Es versammelt über 60 versteckte verschwörungsrelevante Hinweise und mögliche Radikalisierungsanzeichen. Dieses didaktische Hilfsmittel ist eine Ergänzung des Präventionsangebotes für junge Menschen zum zivilcouragierten Umgang mit Verschwörungsmythen, soll aufklären und sie zu kritischem Hinterfragen anregen.
Auf der Webseite www.zivile-helden.de gibt es eine Auflösung sowie weiterführende Informationen über die dargestellten Szenen. Angehörige und Betroffene finden außerdem eine umfangreiche Aufstellung von Beratungsstellen.
Chris+Lea - Zivilcourage zeigen bei Antisemitismus in Verschwörungsmythen
Sie möchten wissen, wie schnell man einer Verschwörung aufsitzt und sich radikalisiert? In unserem interaktiven Video können Sie in einzelne Rollen aus einer Schülergruppe schlüpfen und sich selbst testen. Erkennen Sie konstruierte Verschwörungstheorien? Schaffen Sie es mit Zivilcourage eine antisemitisch motivierte Straftat zu verhindern? Nehmen Sie sich neun Minuten Zeit und „spielen“ sich durch.
interaktives Video "Chris+Lea"
Verschwörungstheorien erkennen (PDF)
(auf klicksafe.de)
Zivile Helden: Fakten, Tipps und Zivilcourage auf Social Media
Laden Sie sich unser passendes kostenloses Social Media Paket zur Bewerbung des Themas herunter: